Angst ausgelacht zu werden überwinden
Die Gelotophobie bezeichnet die Angst, ausgelacht zu werden. Wer unter dieser Angststörung leidet, empfindet das Lachen als negativ. Wir klären über die Angststörung auf und geben Tipps zur Linderung.
- Autorin: Julia Dernbach
- Aktualisiert: 4. Juli 2023
Startseite » Phobien » Gelotophobie (Angst ausgelacht zu werden)
Gelotophobie in Kürze
Die Gelotophobie, oder die Angst ausgelacht zu werden, kann aus speziellen Erlebnissen oder anhaltender Scham entstehen und oft zu einem geringen Selbstwertgefühl führen.
Die Angst verstärkt das Gefühl, lächerlich zu wirken und führt dazu, dass Betroffene jedes Lachen auf sich selbst beziehen. Typische Symptome sind Herzrasen, muskuläre Anspannung, Übelkeit, Zittern, Kurzatmigkeit, Schwitzen und ein trockenes Gefühl in Mund und Hals.
Die Behandlung umfasst oft multimodale Therapieformen, einschließlich Verhaltenstherapie, Tiefenpsychologie, Entspannungstherapie und gegebenenfalls eine medikamentöse Therapie.
Unser Selbsthilfe-eBook ist eine großartige Hilfe für diejenigen, die mit Gelotophobie kämpfen und nach Strategien suchen, um ihre Ängste zu überwinden. Es bietet wertvolle Tipps und Strategien zur Überwindung von Ängsten und Phobien, die insbesondere bei der Gelotophobie nützlich sein können. Dies ist besonders praktisch für diejenigen, die sich vor Ärzten oder Therapeuten fürchten oder nach einer Selbsthilfelösung suchen.
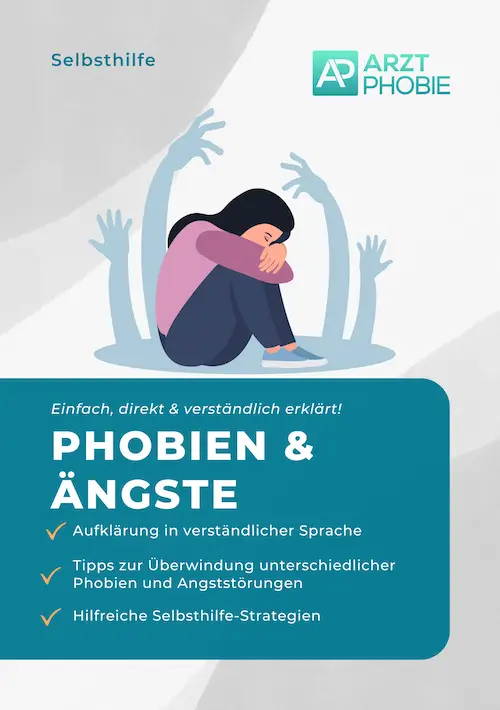
- Über 50 Seiten ✔
- Verständliche Sprache ✔
- Selbsthilfe Strategien ✔
- Tipps für Sofort-Hilfe ✔
- Softcover-Buch: 19,00 EUR ✔
- E-Book: 9,99 EUR ✔
- ➡️ JETZT BESTELLEN
Bedenken und Lösungen
| Bedenken | Lösungen |
|---|---|
| Verlust von Selbstachtung und Lebensfreude | Arbeiten an Selbstwertgefühl durch Psychotherapie und Achtsamkeitsübungen |
| Vermeidung sozialer Kontakte aus Angst, ausgelacht zu werden | Soziales Fertigkeitstraining und schrittweise Exposition gegenüber angstauslösenden Situationen |
| Negative Reaktion auf Lachen und Humor | Verhaltenstherapie zur richtigen Interpretation sozialer Signale und Humor |
| Muskuläre Anspannung und Herzrasen bei Angstauslösern | Entspannungstherapie und Achtsamkeitsübungen zur Linderung körperlicher Symptome |
| Sozialer Rückzug und Depressionen | Therapeutische Interventionen und ggf. medikamentöse Behandlung zur Behandlung von Depressionen |

Ursachen für Gelotophobie
Manchmal sind spezielle Erlebnisse die Auslöser für die Angststörung, doch die ungewöhnliche Scham, die oft mit der Gelotophobie zusammenhängt, kann sich auch mit der Zeit entwickeln.
Typischerweise leiden die Angstpatienten unter einem geringen Selbstwertgefühl. Wenn sie zusätzlich unter Schikanen von anderen Menschen leiden, verschlimmert sich die Angst vor der Lächerlichkeit.
Eine Kindheit in einer schwierigen Umgebung erhöht das Risiko einer Angststörung. Desinteressierte Eltern und emotionale Kälte wirken sich ungünstig auf die gesunde psychische Entwicklung von Kindern aus.
Warning: Undefined array key "icon" in /home/www/arztphobie.com/wp-content/plugins/elementor/includes/widgets/icon-box.php on line 695
Warning: Undefined array key "icon" in /home/www/arztphobie.com/wp-content/plugins/elementor/includes/widgets/icon-box.php on line 708
Jeder Mensch hat seine eigene Sichtweise, die eng mit den Erwartungen und Ängsten verbunden ist. Wer wiederholt ausgelacht wird, geht davon aus, dass er überall Gelächter auslöst, und bezieht jedes Lachen auf seine eigene vermeintliche Ungeschicktheit. Die Betroffenen nehmen dabei die Dinge wahr, die sie erwarten. Auch wenn das Lachen einen anderen Grund hat, meinen sie trotzdem, dass sie ausgelacht werden.
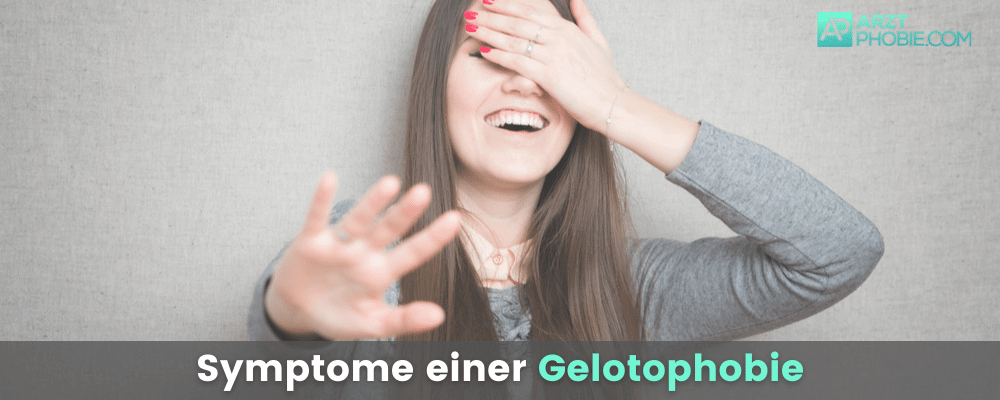
Anzeichen der Gelotophobie
Die Diagnose der Angst vor Lächerlichkeit erfolgt auf der Basis von verschiedenen Bestimmungsmerkmalen. Experten greifen dabei auf einen Fragebogen zurück, der auch Illustrationen von lachenden Personen enthält. Die Angstpatienten sollen einschätzen, wie es zu der Situation gekommen ist und wie das Lachen auf Außenstehende wirkt.
Bei der Feindiagnostik der Angststörung geht es vor allem um die Ursachenforschung. Diese führt der Psychotherapeut oder Psychologe gemeinsam mit dem Patienten durch.
Seit 2008 gibt es wissenschaftliche Studien zur Gelotophobie. Der Psychotherapeut und Psychoanalytiker Michael Titze führte den Begriff 1995 ein. Die Angst, von anderen Menschen ausgelacht zu werden, verstärkt das Gefühl, lächerlich zu wirken. Sie führt dazu, dass die Betroffenen in allen Situationen nach Anzeichen suchen, die diesen Eindruck bestätigen. Wenn jemand lacht, glauben sie, dass es sich um ein spöttisches, herabsetzendes Lachen handelt, dass sie stets auf sich selbst beziehen. Hier zeigt sich die Nähe zur Paranoia.
Warning: Undefined array key "icon" in /home/www/arztphobie.com/wp-content/plugins/elementor/includes/widgets/icon-box.php on line 695
Warning: Undefined array key "icon" in /home/www/arztphobie.com/wp-content/plugins/elementor/includes/widgets/icon-box.php on line 708
Grundsätzlich haben Gelotophobiker Probleme mit Gelächter. Sie empfinden Lachen nicht als fröhlich und lassen sich demzufolge nicht davon anstecken. Sie schätzen sich selbst als humorlos ein. Spezifische Testergebnisse zeigen jedoch, dass auch Gelotophobiker Humor haben können.
Warning: Undefined array key "icon" in /home/www/arztphobie.com/wp-content/plugins/elementor/includes/widgets/icon-box.php on line 695
Warning: Undefined array key "icon" in /home/www/arztphobie.com/wp-content/plugins/elementor/includes/widgets/icon-box.php on line 708
Menschen, die bei anderen ein herabsetzendes Lachen erzeugen und so zur Zielscheibe fremden Spottes werden, möchten am liebsten im Boden versinken. Ihr Drang, sich möglichst unauffällig zu verhalten, verursacht jedoch oft einen gegenteiligen Effekt: Die Bewegungen wirken verkrampft, sodass die Betroffenen noch unbeholfener erscheinen. Der hölzerne Eindruck wird mit dem Begriff Pinocchio-Syndrom treffend dargestellt.
Folgen der Gelotophobie
Wer Angst vor der Lächerlichkeit hat, vermeidet oft soziale Kontakte, denn diese bergen die Gefahr, ausgelacht zu werden.
Wenn jemand einen Scherz macht, beziehen sie das anschließende Gelächter auf sich. In der Folge fühlen sie sich herabgesetzt und schlecht. Diese paranoide Reaktion erschwert es, gesellschaftliche Bindungen einzugehen oder ein fröhliches Gespräch zu führen.
Die Betroffenen gehen mit sich selbst sehr kritisch um und glauben, dass sie einfach kein Talent zum Humor und zur normalen Kommunikation haben. Dieser niedrige Selbstwert löst Minderwertigkeitskomplexe aus, die das Verhalten zusätzlich beeinflussen.
- Verlust von Selbstachtung und Lebensfreude
- Schlecht entwickelte soziale Kompetenz
- psychosomatische Störungen (Erröten, Zittern, Sprachstörungen, Schwindelgefühle)
- negative Reaktion auf Lachen und Humor (Aggressionen, Fluchtverhalten)
- ungewöhnliches, künstlich wirkendes Verhalten
- Versteinerung der Mimik und Gestik (Pinocchio-Syndrom)
- sozialer Rückzug
- Depressionen
Warning: Undefined array key "icon" in /home/www/arztphobie.com/wp-content/plugins/elementor/includes/widgets/icon-box.php on line 695
Warning: Undefined array key "icon" in /home/www/arztphobie.com/wp-content/plugins/elementor/includes/widgets/icon-box.php on line 708
Der kurze Weg zur Paranoia
Jemand in der Nähe lacht laut los und steckt die anderen damit an, doch der Gelotophobiker erstarrt vor Schreck. Sicherlich ist er gemeint; ein Witz wurde über ihn gemacht. Das Problem ist: Die Menschen, die sich vor Lächerlichkeit fürchten, bewerten das Lachen von anderen Personen falsch. Diese paranoide Bewertung verschlimmert die Situation und kann zu dramatischen Folgen führen – beispielsweise durch eine übermäßig aggressive Reaktion.
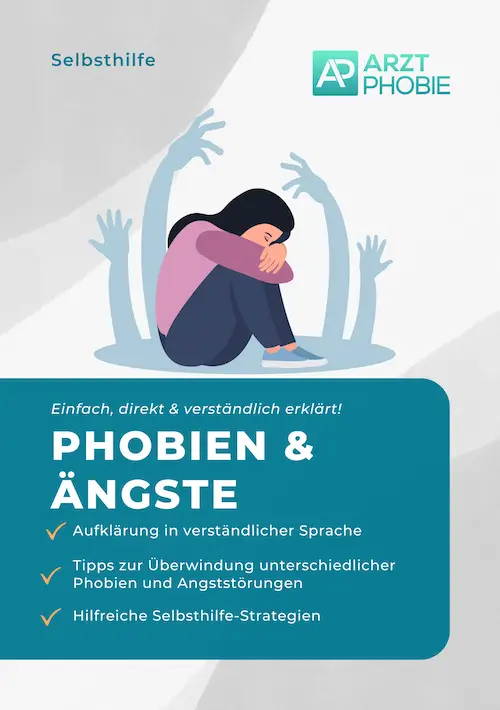
- Über 50 Seiten ✔
- Verständliche Sprache ✔
- Selbsthilfe Strategien ✔
- Tipps für Sofort-Hilfe ✔
- Softcover-Buch: 19,00 EUR ✔
- E-Book: 9,99 EUR ✔
- ➡️ JETZT BESTELLEN
Symptome der Gelotophobie
Eine Gelotophobie äußert sich teilweise ähnlich wie eine soziale Phobie. Allerdings ist sie spezifischer als die generalisierte Angst vor Zurückweisung. Daher gibt es auch bei den Symptomen gewisse Unterschiede.

Tipps gegen Gelotophobie
Wer unter dem Gefühl leidet, ständig ausgelacht zu werden, erkennt oft nicht, dass dies gar nicht der Fall ist. Darum ist es schwierig, die Gelotophobie ohne fremde Hilfe zu überwinden.
Scham und Schuldgefühle können die Situation noch verschlimmern und die Lebensqualität drastisch verringern. Nahestehenden Personen können helfen, gegen das seelische Leid anzukämpfen, wenn die Angstpatienten noch Vertrauen zu ihnen haben. Im Vordergrund steht dabei die Stärkung des Selbstwertgefühls.
Eine ausgewogene Ernährung, sportliche Aktivitäten und ein interessantes Hobby steigern die innere Ausgeglichenheit der Betroffenen. Das ist wichtig für ein positives Selbstbild.
Mit Achtsamkeitsübungen ist es möglich, Angstsymptome wie Kurzatmigkeit zu lindern. Auch Gespräche können helfen, das Bewusstsein und die Selbsteinschätzung der Betroffenen zu verbessern. Doch oft ist die Angststörung so weit fortgeschritten, dass eine professionelle Therapie erforderlich ist.
Geduld gegen die Angst
Wenn die Gelotophobie frühzeitig erkannt und behandelt wird, sind die Erfolgschancen gut. Allerdings kann es Monate oder Jahre lang dauern, bis die Angstbeschwerden komplett verschwinden. Wer von dieser Angststörung betroffen ist, durchlebt eventuell noch lange Zeit danach paranoide Momente.
Doch die Strategien aus der Verhaltens- und Entspannungstherapie helfen dabei, solche Situationen durchzustehen, ohne einen Rückfall zu erleiden. Dafür ist es wichtig, dass die Angstpatienten die Diskrepanz zwischen ihrer paranoiden Vorstellung und der Realität erkennen.
Bei schweren Fällen lässt sich die Angst vor der Lächerlichkeit nicht therapieren. Ohne eine Behandlung kann die Gelotophobie weitere psychische Erkrankungen auslösen. Neben einer Paranoia sind das beispielsweise soziale Ängste und Depressionen. Entsprechend schwierig ist eine erfolgreiche Therapie, was sich negativ auf die Prognose auswirkt.

Therapie der Gelotophobie
Die Verhaltenstherapie für Gelotophobiker beinhaltet das Training von Strategien für den Alltag: Es geht darum, die angstauslösenden Situationen zu meistern.
Oft beginnt die Therapie mit einem Blick in die Vergangenheit, um die Ursachen für die Angststörung zu finden. Möglicherweise sind Erziehungsfehler für die Überempfindlichkeit und Angst verantwortlich.
Je eher die Therapie beginnt, umso größer ist die Aussicht auf Erfolg. Schon für Kinder kann eine Verhaltenstherapie sinnvoll sein. Dabei darf jedoch nicht zu viel Druck entstehen, sonst verstärkt sich das ungewöhnliche Verhalten womöglich.
Multimodale Therapieformen
Die Psychologen, Psychoanalytiker und Psychotherapeuten empfehlen oft einen multimedialen Therapieansatz. Multimodal bedeutet, dass die Therapie mehrere Bereiche umfasst.
Die Verhaltenstherapie dient dazu, dem erhöhten Stresserlebnis etwas entgegenzusetzen und die zwanghaften Gedanken abzuschwächen. Auf diese Weise lernen die Angstpatienten, ihren Alltag angstfrei zu bewältigen.
Weitere Elemente dieser Behandlung sind die Tiefenpsychologie und die Entspannungstherapie. Als begleitende Maßnahme empfehlen die Ärzte oft eine medikamentöse Therapie. Diese dient vorwiegend der Linderung der Symptome
Es ist völlig verständlich, dass die Angst davor, ausgelacht zu werden, mit Schamgefühlen verbunden ist und es schwer macht, darüber zu sprechen. Aber es ist gut zu wissen, dass die meisten Menschen in ihrem Leben mindestens einmal eine ähnliche Erfahrung gemacht haben.
Unsere Selbsthilfe Ratgeber Artikel bieten wertvolle Ratschläge zur Überwindung dieser Ängste und Schamgefühle, um den Weg zu einer Therapie zu ebnen.
Wir möchten unsere Leser ermutigen, sich Unterstützung von Therapeuten zu holen, um ihre Ängste zu bewältigen und ein erfüllteres Leben zu führen.
FAQ zur Gelotophobie
Die Gelotophobie ist die Angst vor dem Ausgelachtwerden. Die Betroffenen empfinden Heiterkeit als eine Art Bedrohung und fühlen sich vom Gelächter herabgesetzt. Die Angststörung hat Anzeichen von Paranoia, da die Angstpatienten das Lachen von anderen Menschen fehlinterpretieren und zumeist als aggressiv wahrnehmen.
Selbstbewusstsein kann durch positives Selbstgespräch, regelmäßige Übung und Vorbereitung, positives Feedback und Unterstützung von Freunden oder einem Therapeuten gestärkt werden.
Für Gelotophobiker ist das Lachen nichts Positives, sondern eine unangenehme soziale Erfahrung. Gelächter löst bei ihnen Angst aus. Das verringert die Lebensfreude und Spontanität der Betroffenen. In der Folge wirken sie oft kalt, distanziert und humorlos.
Für eine erfolgreiche Therapie der Gelotophobie empfiehlt sich ein Ansatz aus mehreren Richtungen, also eine multimodale Therapieform. Oft greifen Tiefen-, Verhaltens- und Entspannungstherapie ineinander, unterstützt von einer Medikation.
Gesunde Angst davor, ausgelacht zu werden, kann dazu führen, dass man in sozialen Situationen vorsichtig agiert, um möglichen Peinlichkeiten vorzubeugen. Krankhafte Angst davor, ausgelacht zu werden, führt jedoch zu einem übermäßigen Vermeidungsverhalten, das die Lebensqualität beeinträchtigen kann.
Autoren, Überprüfung und Gestaltung:
Autorin: Julia Dernbach
Medizinische Überprüfung: Thomas Hofmann
Einarbeitung und Gestaltung: Matthias Wiesmeier

