Süchtig nach Schuhen
Die Schuhsucht ist ein Thema, das in den Medien oft mit einem Augenzwinkern behandelt wird. „Schuhsüchtig? Ich doch nicht. Aber dieses eine Paar Schuhe musste ich einfach haben.“
Aus diesem einen Paar werden dann schnell zehn. Wir erklären dir, wie sich die Sucht nach Schuhen definieren lässt und was du gegen den Drang, immer wieder neue Schuhe zu kaufen, unternehmen kannst. Du solltest dich für dieses Problem nicht schämen.
Außerdem bieten wir dir am Ende unseres Artikels unser Selbsthilfe-Buch an, mit dem du Suchtverhalten und Zwangsstörungen allein überwinden kannst.
- Autor: Matthias Wiesmeier
- Aktualisiert: 14. November 2023
Startseite » Psychologie » Suchtverhalten » Schuhsucht

Süchtig nach neuen Schuhen
Die Schuhsucht ist zwar keine klassische Sucht im offiziellen Sinne, kann aber dein Leben stark negativ beeinflussen. Tatsächlich handelt es sich bei der Schuhsucht um eine psychische Zwangsstörung. Die Grenzen zwischen einer einfachen Vorliebe und einer psychologisch relevanten Verfasstheit sind fließend.
Wenn du für deine Schuhsammlung einen erheblichen Teil der Wohnung reservierst oder sogar einen eigenen Raum dafür hast, solltest du dir Gedanken machen, ob du nicht vielleicht schuh- oder kaufsüchtig bist und eine Therapie in Betracht ziehen solltest.
Der Schlüsselbegriff bei der Schuhsucht ist das „Belohnungsverhalten“. Das Belohnungssystem in deinem Gehirn wird aktiviert, wenn du dir etwas Gutes tust, was zur Ausschüttung von Dopamin, dem sogenannten „Glücksbotenstoff“, führt.
Dieser körpereigene Stoff wirkt ähnlich wie eine Droge. Das Problem bei Süchtigen ist, dass nach einer Zeit eine „normale“ Dopamindosis nicht mehr ausreicht. Entweder muss die Dosis erhöht oder der Zeitraum zwischen den Verabreichungen verkürzt werden.
Im Fall der Schuhsucht bedeutet das: Du kaufst immer mehr Schuhe. Denn nur der Kauf eines neuen Paares Schuhe stimuliert das Belohnungssystem ausreichend, um ein (kurzes, aber intensives) Glücksgefühl zu erzeugen.

Anzeichen einer Schuhsucht
Die Schuhsucht ist eine spezielle Form der Kaufsucht. Charakteristisch für den Kaufzwang ist, dass du bestimmte Güter weit über den eigentlichen Bedarf hinaus erwirbst.
Die gekauften Gegenstände werden oft nicht ausgepackt, sondern irgendwo in der Wohnung aufbewahrt, beispielsweise in einem Schuhzimmer. In schwerwiegenden Fällen werden die Produkte sogar direkt weggeworfen. Negative Konsequenzen wie Verschuldung werden ignoriert.
Du bist dir der Unsinnigkeit deiner Handlungen bewusst, kannst aber nicht dagegen ankämpfen. Wenn du den Kauf unterlässt, stellen sich Entzugserscheinungen ein.
Konsumismus ist der Drang, dem Bedürfnis nach dem Erwerb neuer Konsumgüter ständig nachzugeben. Dahinter steckt der Wunsch nach gesellschaftlicher Anerkennung und die Suche nach Glück und Identität. Menschen, die vom Konsumismus betroffen sind, sehen im Konsum ihren persönlichen Lebenssinn. Der Unterschied zur Kauf- oder Schuhsucht liegt im Problembewusstsein: Beim Konsumismus wird das Problem oft negiert und der persönliche Konsum durch unterschiedlichste Argumente legitimiert. Allerdings ist der Weg vom Konsumismus in eine Kaufsucht oft nicht weit.

Gefahren der Schuhsucht
Eine Schuhsucht wirkt sich auf zwei Ebenen aus. Zunächst die finanzielle: Schuhe kosten Geld, und viele Schuhe kosten viel Geld. Wenn das notwendige Geld nicht vorhanden ist, führt das zu Schulden und schwerwiegenden finanziellen Problemen.
Du könntest sogar auf die schiefe Bahn geraten, Ladendiebstahl begehen oder versuchen, auf illegale Weise schnell an Geld zu kommen.
Die zweite Ebene ist die psychisch-soziale. Du bist dir deiner Lage bewusst und leidest unter negativen Gedanken, die bis zum Selbsthass und Depressionen führen können. Du ziehst dich zurück und gehst auf Distanz zu deinem Umfeld. Die durch Vereinsamung ausgelösten negativen Gefühle bekämpfst du oft durch den Kauf von neuen Schuhen und dem damit verbundenen Dopaminausstoß.
Auslöser der Schuhsucht
Die Kaufsucht ist eine psychische Störung der Persönlichkeit, oft basierend auf einem geringen Selbstwertgefühl. Durch die Kaufhandlung vertreibst du negative Gedanken kurzfristig.
Wie bei vielen psychischen Störungen ist die Ursache oft ein persönliches Trauma. Eine gestörte Impulskontrolle kann ebenfalls zur Entstehung deiner Sucht nach neuen Schuhen beitragen.
Eine wichtige Rolle spielt der „Frustkauf“. Du konsumierst, um negative Gefühle und Gedanken auszublenden. Aus dem gelegentlichen Kauf kann schnell eine Gewohnheit werden. Anstatt sich mit negativen Erfahrungen und Gefühlen auseinanderzusetzen, wird eine Ersatzhandlung ausgeführt.
Interessantes Detail: Die Kaufsucht, einschließlich der Sucht, neue Schuhe kaufen zu wollen, existiert als medizinisches Problem vorwiegend in der westlichen Welt. Dort, wo großen Bevölkerungsteilen ein entsprechendes Einkommen zur Verfügung steht und eine große Auswahl an Waren vorhanden ist.
Einfluss von Werbung auf die Schuhsucht
Die ständige Präsenz von neuen Modetrends und Rabattaktionen in der Werbung kann dazu führen, dass sich dein Verlangen nach neuen Schuhen verstärkt.
Die gezielte Ansprache bestimmter Zielgruppen durch die Werbeindustrie kann bewirken, dass du mit geringem Selbstwertgefühl vermehrt dazu neigst, deinen Selbstwert durch den Kauf neuer Schuhe aufzubessern.
In der heutigen Zeit, in der soziale Medien eine große Rolle spielen, werden neue Schuhtrends schnell verbreitet und erhöhen somit den Druck, immer topmodisch zu sein.
Du kannst dadurch in einen Kreislauf geraten, in dem du immer wieder neue Schuhe kaufst, um dir selbst Bestätigung zu geben oder Anerkennung von anderen zu erhalten.
Warum kaufst du neue Schuhe?
Eine Schuhsucht kann sich in verschiedenen Verlangen und Kompensationsverhalten äußern. In der folgenden Tabelle haben wir einige dieser Verhaltensmuster zusammengetragen und verglichen, um ein besseres Verständnis für die Mechanismen hinter der Schuhsucht zu gewinnen.
| Verlangen | Kompensationsverhalten |
|---|---|
| Stress | Schuhe kaufen als Beruhigung |
| Langeweile | Schuhe kaufen als Zeitvertreib |
| Drang nach Anerkennung | Schuhe kaufen als Statussymbol |
| Niedriges Selbstwertgefühl | Schuhe kaufen als Selbstbestätigung |
| Sammlerinstinkt | Ständiges Sammeln und Aufbewahren von Schuhen |

Tipps gegen Schuhsucht
Der erste Schritt besteht darin, dein eigenes Verhalten zu erkennen und zu akzeptieren, dass du möglicherweise eine Schuhsucht hast. Beginne damit, regelmäßig dein Kaufverhalten zu reflektieren und frage dich, ob du wirklich neue Schuhe brauchst oder ob es nur um eine kurzfristige Befriedigung geht. So kannst du dein Kaufverhalten besser kontrollieren und einschränken.
Es kann sehr hilfreich sein, dir selbst Grenzen zu setzen, wie beispielsweise nur eine bestimmte Anzahl von Schuhen pro Jahr zu kaufen. Dadurch kannst du deinen Konsum kontrollieren und einschränken.
Versuche herauszufinden, welche Auslöser dich immer wieder zum Kauf neuer Schuhe verleiten, wie etwa Stress oder Langeweile. So kannst du gezielt gegensteuern und alternative Bewältigungsstrategien finden.
Suche nach alternativen Aktivitäten, um negative Gefühle oder Langeweile zu bekämpfen, anstatt immer wieder neue Schuhe zu kaufen. Sport, Musik oder Lesen sind nur einige Beispiele. Suche auch nach alternativen Belohnungen für dich selbst, die nichts mit dem Kauf neuer Schuhe zu tun haben, wie etwa ein Wellness-Tag oder ein neues Hobby. So kannst du dich selbst belohnen, ohne in alte Verhaltensmuster zurückzufallen.
Verkaufe oder spende alte Schuhe, um Platz für Neues zu schaffen und ein Bewusstsein für deinen eigenen Konsum zu entwickeln. Das kann dir helfen, deine Schuhsammlung zu reduzieren und deine Schuhsucht besser zu bewältigen.
Sprich mit Freunden oder Familie über dein Problem und suche nach Unterstützung. Manchmal kann es schon helfen, einfach darüber zu sprechen und gemeinsam nach Lösungen zu suchen.
Versuche den Einfluss von Werbung auf dein Kaufverhalten zu reduzieren, indem du beispielsweise weniger Zeit auf sozialen Medien verbringst oder gezielt Werbung für Schuhe blockierst.
In schwereren Fällen kann eine professionelle therapeutische Behandlung bei einem Psychologen oder Psychotherapeuten hilfreich sein. Dort kannst du lernen, deine Schuhsucht besser zu verstehen und zu bewältigen. Oft genügt allerdings auch unser Selbsthilfe Buch, damit du die Auslöser besser verstehst und die Sucht alleine überwinden kannst.
Therapie gegen Schuhsucht
Die Schuhsucht ist, wie bereits erwähnt, eine Zwangsstörung. Auch wenn sie nicht offiziell als Sucht anerkannt ist, kann eine entsprechende Therapie sehr hilfreich sein.
Eine besondere Herausforderung bei der Behandlung ist, dass Suchtkranken normalerweise geraten wird, den Kontakt zum Suchtmittel zu meiden. Dies ist beim Kauf oder Tragen von Schuhen oft nicht möglich.
Auf der kognitiven Ebene lernst du, deine Gedanken und Überzeugungen bezüglich des Schuhkaufs zu hinterfragen und zu ändern. Ziel ist es, deine Denkweise zu verändern, um die Schuhsucht zu überwinden.
Hier liegt der Fokus auf der Entwicklung neuer Verhaltensweisen und dem Verzicht auf den Kauf von Schuhen. Du lernst Strategien, um mit dem Kaufzwang umzugehen und deine Handlungen zu kontrollieren.
Auf dieser Ebene geht es darum, die emotionalen Ursachen deiner Schuhsucht zu erkennen und zu bearbeiten. Ziel ist es, alternative Wege zu finden, um mit deinen Emotionen umzugehen und negative Gedanken und Gefühle zu reduzieren.
Schamgefühle überwinden
An einer Zwangsstörung zu leiden ist belastend. Du bist dir der Unsinnigkeit und Gefährlichkeit deiner Handlungen bewusst.
Dennoch schaffst du es nicht, das Muster von Frustration hin zum Impulskauf und dann wieder zur Frustration zu durchbrechen. Durch den Schuhkauf erfährst du zwar kurzfristige Erleichterung, aber echte Freude bleibt aus.
Obwohl offiziell nicht als eigenes Krankheitsbild anerkannt, kann die Schuhsucht wie alle anderen Süchte behandelt werden. Kognitive Verhaltenstherapie und Gruppentherapien sind dabei äußerst wirksam. In schweren Fällen, die mit Depressionen zusammenhängen, ist medikamentöse Behandlung gängig.
Die Einsicht, dass etwas nicht stimmt, ist der erste Schritt. Du kannst entsprechende Therapeuten über Google finden. Wenn du dich vor dem Besuch beim Therapeuten fürchtest, bietet unser Selbsthilfe-Ratgeber hilfreiche Ratschläge, um Ängste und Schamgefühle zu überwinden.
Selbsthilfe Buch
Wenn du unter Schuhsucht leidest und eine Therapie für dich nicht infrage kommt, könnte unser Selbsthilfe-Buch gegen Suchtverhalten und Zwangsstörungen die Lösung sein. Es umfasst über 60 Seiten mit praktischen Anleitungen und Strategien, die du nutzen kannst, um deine Schuhsucht selbständig zu überwinden.
Das Buch ist sofort als PDF herunterladbar und kann auf deinem Handy, Computer oder Laptop gelesen werden. Es erfordert nur eine einmalige Zahlung und ist keine Abo-Falle. Viele Menschen haben bereits mithilfe unseres Buches Suchtverhalten und Zwangsstörungen eigenständig bewältigt. Solltest du weitere Unterstützung benötigen, kann das Buch auch der Anstoß sein, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen.
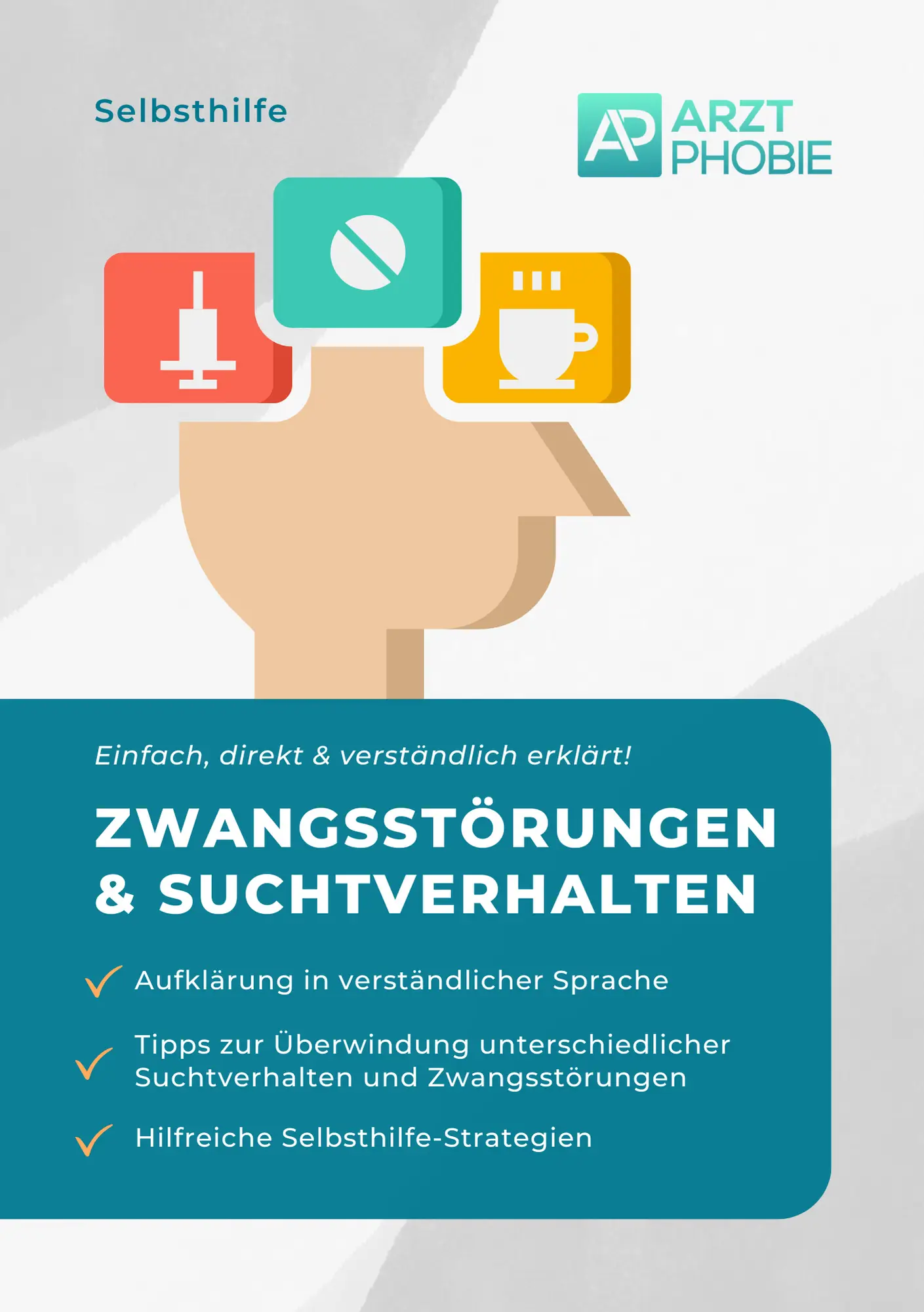
- Über 60 Seiten ✓
- In verständlicher Sprache ✓
- Mit Anleitungen und Übungen ✓
- Tipps für Sofort- & Selbsthilfe ✓
- Softcover: 19,00 EUR
- E-Book: 9,99 EUR
- ➡️ JETZT BESTELLEN ✓
FAQ zur Schuhsucht
Die Schuhsucht ist eine psychologische Zwangsstörung. Keine offiziell anerkannte Suchterkrankung, aber als spezifische Ausprägung der Kaufsucht eben klar eine Zwangsstörung.
Schuhsucht zeichnet sich dadurch aus, dass das Kaufverhalten der Betroffenen zwanghaft ist und häufig negative Konsequenzen nach sich zieht. Im Gegensatz dazu ist ein normaler Schuhkonsum nicht zwanghaft und beeinträchtigt nicht das alltägliche Leben.
Da wären einerseits die finanziellen Auswirkungen. Wer immer mehr Schuhe kaufen will, benötigt immer mehr Geld. Oft verschulden sich Betroffene deshalb sogar. Die psychischen Effekte sollten ebenfalls nicht außer Acht gelassen werden. Da Schuhsüchtige wissen, dass sie ein Problem haben, fühlen Sie sich schlecht und kultivieren negative Gedanken. Das Selbstwertgefühl wird schwächer, der Selbsthass hingegen nimmt zu und kann sogar in Depressionen müden.
Von anderen Süchten bekannte Behandlungsmethoden sind auch bei der Schuhsucht zu empfehlen. Eine Kaufsucht wird in der Regel meist durch eine Kognitive Verhaltenstherapie und/oder Gruppentherapie therapieren. Dadurch lassen sich festgefahrene Verhaltensmuster lösen und positive Ersatzhandlungen finden. Zuletzt verschob sich der Fokus außerdem immer mehr auf die Beseitigung von zugrunde liegenden Traumata. In besonders schweren Fällen können Süchte auch medikamentös behandelt werden.
Ja, es besteht die Möglichkeit, dass Schuhsucht zu anderen Süchten führen kann, da es sich um ein suchtähnliches Verhalten handelt. Wir raten daher dazu, das Verhalten frühzeitig zu erkennen und zu behandeln.
Ja, es gibt bekannte Persönlichkeiten wie beispielsweise Imelda Marcos oder Mariah Carey, bei denen ein auffälliges Kaufverhalten von Schuhen bekannt ist.
Obwohl eine Schuhsucht oft mit Frauen assoziiert wird, kann sie auch bei Männern auftreten. Es gibt keine geschlechtsspezifischen Unterschiede im Auftreten der Störung.
Quellen:
- Kaufsucht: Wenn Konsum zur Krankheit wird – AOK

Dieser Artikel wurde von Matthias Wiesmeier verfasst. Selbstständiger Schriftsteller und Webdesigner seit 2005. Fachbereiche: Gesundheit, Psychologie, Sport.

