Alkoholsucht überwinden
Die Alkoholsucht zählt zu den weit verbreiteten Suchterkrankungen in Deutschland und stellt nicht nur für die Betroffenen, sondern auch für ihr Umfeld eine große Herausforderung dar.
Doch wann beginnt Alkoholmissbrauch und wann wird er zur Abhängigkeit? Welche Stadien der Sucht gibt es und welche Auswirkungen hat der Alkoholkonsum auf das Leben? Welche Überwindungsmethoden stehen zur Verfügung und wie kann dich das soziale Umfeld unterstützen?
Dieser Artikel bietet einen umfassenden Einblick in die Thematik der Alkoholsucht und liefert hilfreiche Informationen, die den Weg zu einem suchtfreien Leben erleichtern können. Außerdem empfehlen wir dir unser Selbsthilfe Buch zur Überwindung von Zwangsstörungen und Suchtverhalten.
- Autor: Matthias Wiesmeier
- Aktualisiert: 14. November 2023
Startseite » Psychologie » Suchtverhalten » Alkoholsucht
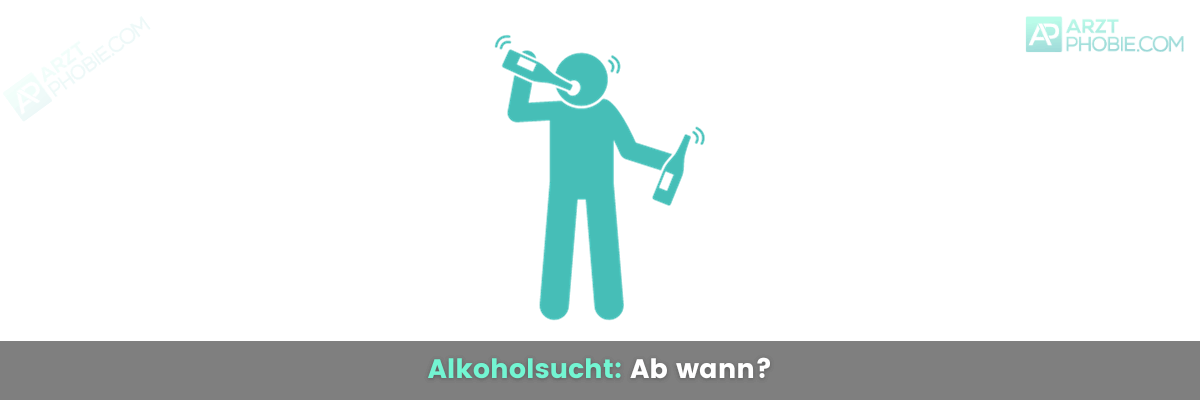
Alkoholsucht: Ab wann?
Es gibt präzise Kriterien, die Wissenschaft und Medizin heranziehen, um zu bestimmen, wann jemand alkoholabhängig ist.
Eine Alkoholabhängigkeit wird angenommen, wenn innerhalb eines Jahres drei oder mehr der folgenden Punkte gleichzeitig erfüllt sind:
Du spürst ein starkes Verlangen, Alkohol zu trinken.
Um die gewünschte Wirkung zu erreichen, musst du immer mehr trinken.
Du kannst nicht mehr steuern, wann du beginnst oder aufhörst zu trinken und welche Mengen du konsumierst.
Du vernachlässigst Hobbys und Interessen zugunsten des Alkoholkonsums. Der Zeitaufwand für den Umgang mit Alkohol nimmt zu.
Du trinkst weiter, obwohl du die schädlichen Folgen für deinen Körper und dein psychisches Wohlbefinden sowie für dein soziales Leben kennst.
Wenn du nicht trinkst, zeigen sich körperliche Symptome wie Schwitzen oder Zittern.
Falls du oder jemand in deinem Umfeld drei oder mehr dieser Symptome gleichzeitig zeigt, besteht die Möglichkeit einer Alkoholsucht. Es ist wichtig, sich dieser Anzeichen bewusst zu sein und an eine frühzeitige Hilfe zu denken.
Angst vor Alkoholsucht überwinden
Eine schleichende Alkoholabhängigkeit kann schneller eintreten als erwartet. Oft wollen Betroffene sich das Problem nicht eingestehen und reden es mit „Ich kann ja jederzeit wieder aufhören“ schön. In Wirklichkeit hat sich in vielen Fällen bereits eine Abhängigkeit entwickelt.
Wir können jedem, der sich betroffen fühlt, ans Herz legen, sich dem Thema mit entsprechender Ernsthaftigkeit zu öffnen. Schamgefühle, weil du denkst, du würdest über dem Problem stehen und wärst nicht so „schwach“, sind hier eindeutig fehl am Platz.
- Ich habe das im Griff, ich kann meinen Konsum kontrollieren.
- Davon muss niemand erfahren.
- Es ist ja nur eine kleine Menge Alkohol.
- Das ist doch normal.
Dies sind typische Beispiele für Irrglauben und das typische „Schönreden“ der Problematik mit Alkohol. Der Konsum kann nicht ernsthaft als Kontrolle betrachtet werden, wenn in Wirklichkeit der Alkohol die Kontrolle über das Handeln hat. Dass davon niemand erfahren muss, ist ein eindeutiges Indiz für eine heimliche, aber trotzdem existente Abhängigkeit.
Auch geringe Mengen Alkohol können bei Regelmäßigkeit schädlich sein. Da Alkohol, zumindest in Deutschland, nicht verboten ist und gesellschaftlich akzeptiert wird, scheint er schnell als „normal“ akzeptiert zu werden.
Wenn du dich anonym über Probleme mit Alkohol unterhalten möchtest, kannst du das heutzutage idealerweise über das Internet oder das Telefon tun.
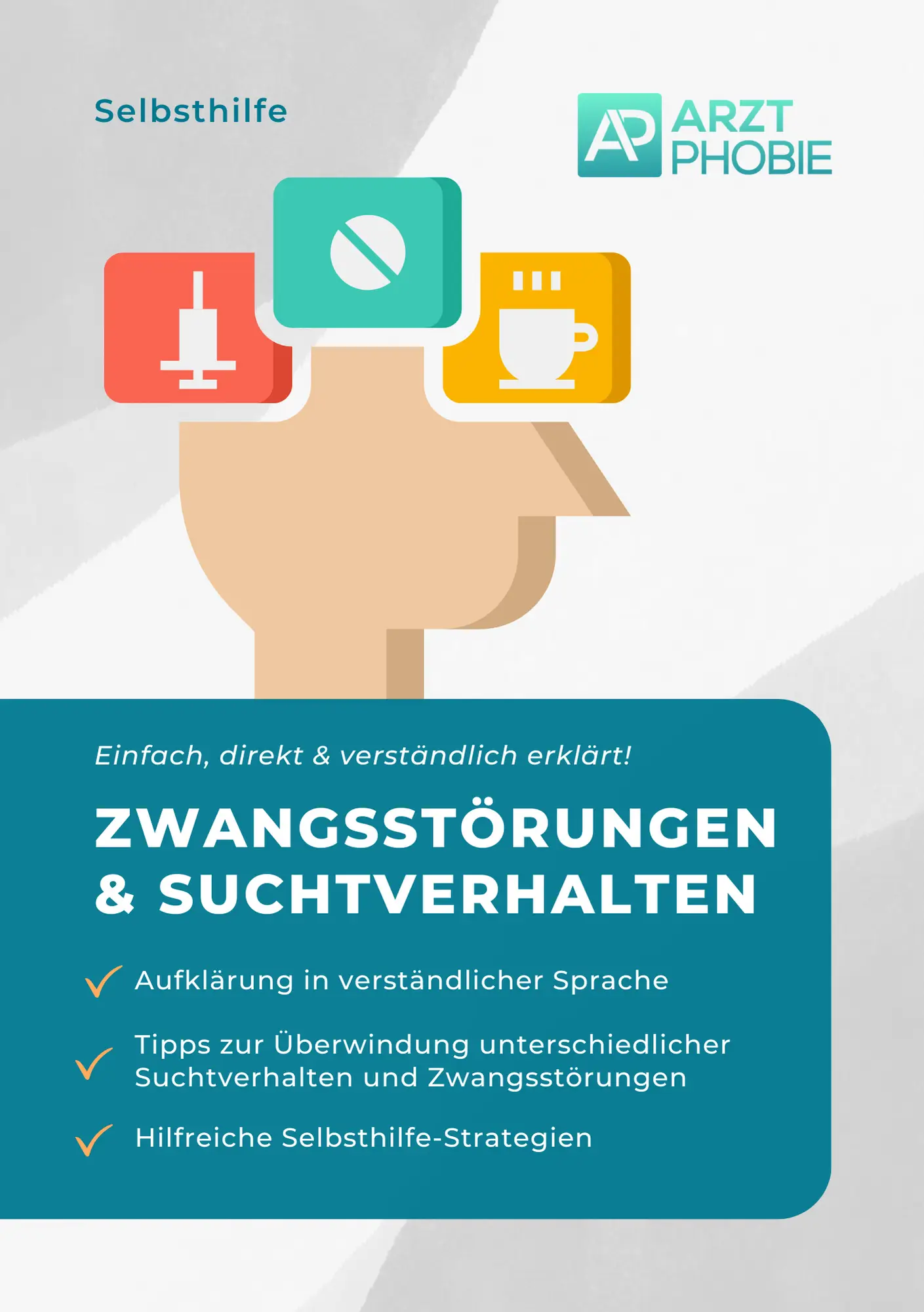
- Über 60 Seiten ✓
- In verständlicher Sprache ✓
- Mit Anleitungen und Übungen ✓
- Tipps für Sofort- & Selbsthilfe ✓
- Softcover: 19,00 EUR
- E-Book: 9,99 EUR
- ➡️ JETZT BESTELLEN ✓
Alkoholsucht: Phasen
Der US-amerikanische Mediziner Elvin M. Jellinek hat bereits 1960 eine sogenannte Alkoholikertypologie erstellt. Das „Jellinek-Schema“ ist bis heute die gebräuchlichste Klassifikation des Alkoholismus in der Medizin.
Es besteht aus vier Phasen, die wiederum in 45 Stufen unterteilt sind. Trennscharf ist die Unterscheidung der vier Phasen dabei nicht; die Übergänge sind oftmals unmerklich fließend.
- Voralkoholische Phase
- Anfangsphase
- Kritische Phase
- Chronische Phase
Wie die jeweiligen Phasen im Detail aussehen, sehen wir uns nun etwas genauer an:
Diese wird auch als symptomatische Phase bezeichnet. Sie ist dadurch charakterisiert, dass weder eine körperliche noch eine psychische Abhängigkeit vorliegt. Der Betroffene hat die vollständige Kontrolle über sein Trinkverhalten.
Problematisch an dieser Phase ist, dass Alkohol immer öfter aufgrund seiner Wirkung konsumiert wird – also zur Belohnung nach einem harten Tag bei der Arbeit, das Sieger- oder Verliererbier nach einem Fußballmatch etc. Es entsteht eine mentale Verknüpfung zwischen Alkohol und Entspannung. Andere Lösungsansätze für stressige Situationen, wie beim Sport auspowern oder ein gutes Buch lesen, rücken zusehends in den Hintergrund.
In der Anfangs- oder Prodromalphase ändert sich der Status von Alkohol für den Betroffenen von einem Genussmittel zum Problemlöser. Die ersten gravierenden Symptome treten auf, dazu zählen Gedächtnislücken, ein gesteigertes Verlangen nach Alkohol sowie Veränderungen im Trinkverhalten und im Umgang mit dem Suchtmittel.
Wer sich in dieser Phase befindet, weiß meistens selbst, dass seine Trinkgewohnheiten problematisch sind, möchte dieses aber nicht ändern, weil er das Trinken doch noch als angenehm empfindet. Dieser Widerspruch erzeugt Schuldgefühle, die der Betroffene mit Alkohol zu lindern sucht – ein Teufelskreis beginnt.
Du bist nun vollständig abhängig. Die Kontrolle über den Konsum ist nur noch bedingt möglich, das Trinken bestimmt dein Denken und Handeln gänzlich. Dadurch entstehen weitere Schuldgefühle, aufgrund derer du dich noch mehr zurückziehst und noch mehr trinkst.
Du gehst in diesem Stadium dazu über, ein neues und sozial vermeintlich verträglicheres Trinksystem zu etablieren: „Ich trinke nur noch abends.“ oder „Ich trinke nur noch Bier, keinen Schnaps mehr.“ Es kommt zur verstärkten Reduktion von sozialen Kontakten und zur Vernachlässigung von Hobbys. Du versuchst, dich mit Pseudoerklärungen aus der Affäre zu ziehen und deine Abhängigkeit zu negieren. Du verhältst dich deiner Umgebung gegenüber feindselig-aggressiv und fühlst dich permanent missverstanden. Die ersten körperlichen Folgen stellen sich ein, wie Herz-Kreislauf-Probleme, erhöhte Leberwerte und sexuelle Störungen (z.B. erektile Dysfunktion bei Männern)
Familienmitglieder ziehen sich ebenfalls aus der Öffentlichkeit zurück, weil sie die Abhängigkeit decken wollen. Innerhalb der Familie kommt es aufgrund deiner Aggressivität immer öfter zu Verwerfungen.
Wenn du dich in dieser Phase befindest, weißt du meistens selbst, dass deine Trinkgewohnheiten problematisch sind, möchtest dieses aber nicht ändern, weil du das Trinken noch als angenehm empfindest. Dieser Widerspruch erzeugt Schuldgefühle, die du mit Alkohol zu lindern versuchst. Um sozialen Konsequenzen zu entgehen, wird immer häufiger heimlich getrunken, kritische Gespräche über das Thema Alkohol werden vermieden. Da der Toleranzeffekt einsetzt, musst du immer größere Mengen konsumieren, um die gewünschte Wirkung zu erzielen. In der Prodromalphase versuchst du auch oft, andere zum Trinken zu überreden, damit dein problematisches Verhalten nicht so auffällt.
Du wirst nun voll und ganz von deiner Sucht beherrscht. Der Effekt des Alkohols ist keine Entlastung mehr, sondern nur noch Erleichterung über das Verschwinden der Entzugssymptome. Wenn du versuchst, auf Alkohol zu verzichten, durchleidest du schwerste Entzugserscheinungen wie Beschwerden im Magen-Darm-Trakt (Übelkeit, Erbrechen), Tremor (unkontrollierbares Zittern), Schweißausbrüche, stark erhöhte Blutdruck- und Pulswerte sowie Angst- und Panikattacken.
Der körperliche und geistige Verfall ist immanent, die Abhängigkeit nimmt ein lebensbedrohliches Ausmaß an. Da ein Alkohol-Dauerkonsum das potenteste bekannte „Depressivum“ ist, entwickelst du immer stärkere Depressionen, die oftmals in Suizidversuche münden. Wir empfehlen dir, diese Warnzeichen ernst zu nehmen und professionelle Hilfe mit Unterstützung oder eine Selbsthilfe zu suchen.
Angehörige von Alkoholiker
Eine Alkoholsucht betrifft niemals nur den Trinker selbst, sie hat Auswirkungen auf das gesamte soziale Umfeld. Und diese können teilweise gravierend sein. Sie betreffen sowohl die körperliche als auch die psychische Ebene und sind neben der Angst um das Leben eines geliebten Menschen ein weiterer Grund dafür, dass auch du als Angehöriger Angst vor einer Alkoholsucht hast.
Als Angehöriger wirst du meist als Erster auf eine sich anbahnende Abhängigkeit aufmerksam. In vielen Fällen hat eine Konfrontation mit dem Betroffenen aber nicht den gewünschten Effekt, sondern verstärkt dessen unsoziales Verhalten nur noch. Du machst dir in weiterer Folge selbst Vorwürfe, die falsche Strategie gewählt zu haben bzw. dem Betroffenen nicht helfen zu können. Das belastet deine Psyche.
Alkoholsüchtige werden mit Fortdauer der Abhängigkeit oft aggressiver und feindseliger. Das kann in manchen Fällen so weit gehen, dass es zu Handgreiflichkeiten gegenüber Familienangehörigen und anderen Vertrauenspersonen kommt.
Unter Co-Abhängigkeit versteht man ein Verhalten von Familienangehörigen oder engen Freunden, das die Symptome der Suchterkrankung minimiert oder bagatellisiert. Sie begleichen etwa durch die Sucht entstandene Schulden, entschuldigen unpassendes Verhalten oder reden daraus resultierende Konsequenzen klein. Sie versuchen alles, um den Schein zu wahren und unterstützen dadurch den Alkoholsüchtigen in seiner Lebensweise. Auch Co-Abhängige ziehen sich oft aus dem gewohnten sozialen Umfeld zurück.
Behandlung von Alkoholsucht
Die Therapie einer Alkoholsucht ist ohne einen entsprechenden Entzug nicht möglich. Hinter dem Konzept steckt aber deutlich mehr, als nur auf Alkohol zu verzichten. Es bedarf vieler unterschiedlicher Ansätze, die im Zusammenspiel dafür sorgen können, dass ein Betroffener die Abhängigkeit hinter sich lässt.
Anpassung der Therapie an die individuelle Situation und Aufbau der Motivation, überhaupt eine Therapie durchziehen zu wollen.
Der körperliche Alkoholentzug dauert in der Regel zwischen 3 und 7 Tagen. Da dabei starke Entzugserscheinungen auftreten, ist eine stationäre Aufnahme für die Dauer dieser Phase empfehlenswert.
Stabilisierung des Patienten durch umfassende Maßnahmen im körperlichen, psychischen und sozialen Bereich. Die enge Zusammenarbeit mit Psycho- und Sozialtherapeuten ist hier wichtig. Abhängig von deiner Situation und der Ausprägung der Sucht wird diese Phase stationär, teilstationär oder ambulant durchgeführt.
Das Ziel ist die Stabilisierung der Behandlungserfolge und die Sicherstellung einer langfristigen Versorgung des Patienten. Das kann etwa durch den regelmäßigen Besuch einer Selbsthilfegruppe, durch eine individuelle Psychotherapie oder das ebenso regelmäßige Aufsuchen einer Suchtberatungsstelle erfolgen. Wir unterstützen dich bei der Suche nach den passenden Behandlungsoptionen und begleiten dich auf diesem Weg.
Medikamente gegen Alkoholsucht
Im Rahmen einer Entziehungskur kommen Medikamente zum Einsatz, um zum einen die Symptome zu lindern und den Leidensdruck zu verringern, zum anderen, um die Lust auf Alkohol zu dämpfen.
Präparate wie Antabus (verursacht unangenehme Reaktionen bei Alkoholkonsum) oder Campral (reduziert das Verlangen nach Alkohol) werden dafür verwendet. Adepend verringert das Hochgefühl nach dem Alkoholkonsum.
Möchtest du Medikamente während der Nachsorge nutzen, kannst du diese bei Online-Apotheken bestellen. Rezeptfreie Präparate sind problemlos erhältlich, für verschreibungspflichtige Medikamente benötigst du ein Rezept.
Online Rezept Service? Medikamente wie Antabus und Campral können über Online-Diagnose von Anbietern wie Dokteronline verschrieben und zugesendet werden, wodurch der persönliche Arztbesuch nicht zwingend notwendig ist.
Psychotherapie bei Alkoholsucht
Die psychotherapeutische Behandlung der Alkoholsucht beginnt eigentlich erst dann, wenn der körperliche Entzug abgeschlossen ist. Das vorrangige Ziel dieses Abschnitts ist es, einen Rückfall zu verhindern. Ein standardisiertes Vorgehen gibt es nicht, jede Therapie wird individuell angepasst. Psychologische Behandlung von Alkoholsucht ist in unterschiedlichen Formen möglich.
- Kognitive Verhaltenstherapie
- Psychoanalytische/tiefenpsychologisch fundierte Therapie
- Paar- und Familientherapie
Wer keinen passenden Psychotherapeuten in seiner Nähe findet oder die Sitzungen lieber in der Vertrautheit der eigenen vier Wände durchführen möchte, der kann seine Therapiesitzungen – falls es für den Therapeuten in Ordnung ist – ins Internet verlegen.
Selbsthilfegruppen gegen Alkoholsucht
Wie bei allen anderen Traumata auch – und nichts anderes ist eine Alkoholsucht im Grunde – ist der Austausch mit Menschen wichtig, die dasselbe durchgemacht haben.
Der Besuch von Selbsthilfegruppen fällt in die vierte und letzte Phase der Therapie einer Alkoholsucht, die sogenannte Nachsorge. Es werden auch spezielle Selbsthilfegruppen angeboten, in denen sowohl Betroffene selbst als auch deren Angehörigen sich austauschen können.

Selbsthilfe bei Alkoholsucht
Die Selbsthilfe spielt eine entscheidende Rolle auf dem Weg aus der Alkoholsucht. Es beginnt damit, dass du dein Trinkverhalten erkennst und den Wunsch entwickelst, es zu ändern. Die Selbsthilfe bei Alkoholsucht ist ein persönlicher und individueller Prozess. Es erfordert Mut, sich den eigenen Problemen zu stellen und konsequent neue Wege zu gehen. Aber mit Entschlossenheit und den richtigen Strategien kannst du den Weg in ein unabhängiges und zufriedenes Leben finden
Hier sind einige Schritte, die du selbst unternehmen kannst, um die Kontrolle zurückzugewinnen:
Mache dir klar, dass du nicht allein bist. Viele Menschen haben ihren Weg aus der Alkoholsucht gefunden. Schreibe deine Gründe auf, warum du aufhören möchtest zu trinken, und setze dir klare, erreichbare Ziele. Zum Beispiel kannst du damit beginnen, bestimmte Tage als alkoholfrei zu bestimmen oder eine Obergrenze für deinen Konsum festzulegen.
Spreche mit Freunden und Familie über dein Ziel, den Alkoholkonsum zu reduzieren oder ganz aufzuhören. Ihre Unterstützung kann ein wichtiger Motivationsfaktor sein. Du kannst dich auch anonymen Selbsthilfegruppen anschließen, wo du Verständnis und nicht wertende Unterstützung findest.
Halte Buch über deine Trinkgewohnheiten und identifiziere Auslöser, die dich zum Trinken verleiten. Lerne alternative Bewältigungsstrategien für Stress und Emotionen, die bisher zum Alkoholkonsum geführt haben. Aktivitäten wie Sport, Hobbys oder ehrenamtliche Arbeit können helfen, die Leere zu füllen, die der Alkohol hinterlassen hat.
Langfristige Strategien
Langfristig ist es sehr wichtig, dass du neue Gewohnheiten entwickelst:
Langfristig ist es wichtig, dass du neue Gewohnheiten entwickelst, die ein erfülltes Leben ohne Alkohol unterstützen:
Etabliere einen regelmäßigen Tagesablauf mit ausgewogener Ernährung, genug Schlaf und Bewegung. Diese Routinen können dein Wohlbefinden steigern und den Wunsch nach Alkohol verringern.
Arbeite an deiner persönlichen Entwicklung. Das kann die Auseinandersetzung mit ungelösten emotionalen Problemen beinhalten oder den Aufbau von Selbstwert und Selbstvertrauen durch neue Herausforderungen und Erfolge in Beruf und Freizeit.
Wenn du merkst, dass du alleine nicht weiterkommst, zögere nicht, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Eine Therapie kann dir zusätzliche Hilfe an die Hand geben, um deine Sucht besser zu verstehen und zu bewältigen.
Selbsthilfe Buch
Neben den in unserem Artikel beschriebenen Selbsthilfemaßnahmen kann unser speziell entwickeltes Selbsthilfe-Buch ein wertvoller Begleiter auf deinem Weg aus der Abhängigkeit sein. Es ist besonders hilfreich, wenn du dich selbstständig mit deiner Alkoholsucht auseinandersetzen möchtest oder Bedenken hast, eine professionelle Therapie in Anspruch zu nehmen.
Unser Buch bietet dir nicht nur Einblicke in die Ursachen von Suchtverhalten, sondern auch praktische Anleitungen, wie du mit Zwangsstörungen und Sucht umgehen kannst. Es hilft dir zu verstehen, was deine Sucht auslöst und bietet dir konkrete Strategien und Techniken, um diese Herausforderungen zu bewältigen. Dies ist besonders wertvoll, wenn du Bedenken hast, ärztliche Hilfe zu suchen oder wenn eine Therapie für dich derzeit nicht in Frage kommt.
Mit über 60 Seiten bietet unser Buch eine hilfreiche Unterstützung, die sofort als PDF heruntergeladen und auf deinem Handy, Computer oder Laptop gelesen werden kann. Wir legen großen Wert darauf, dass unser Angebot transparent und zugänglich ist. Deshalb handelt es sich bei diesem Buch um einen einmaligen Kauf ohne versteckte Abonnements oder zusätzliche Kosten.
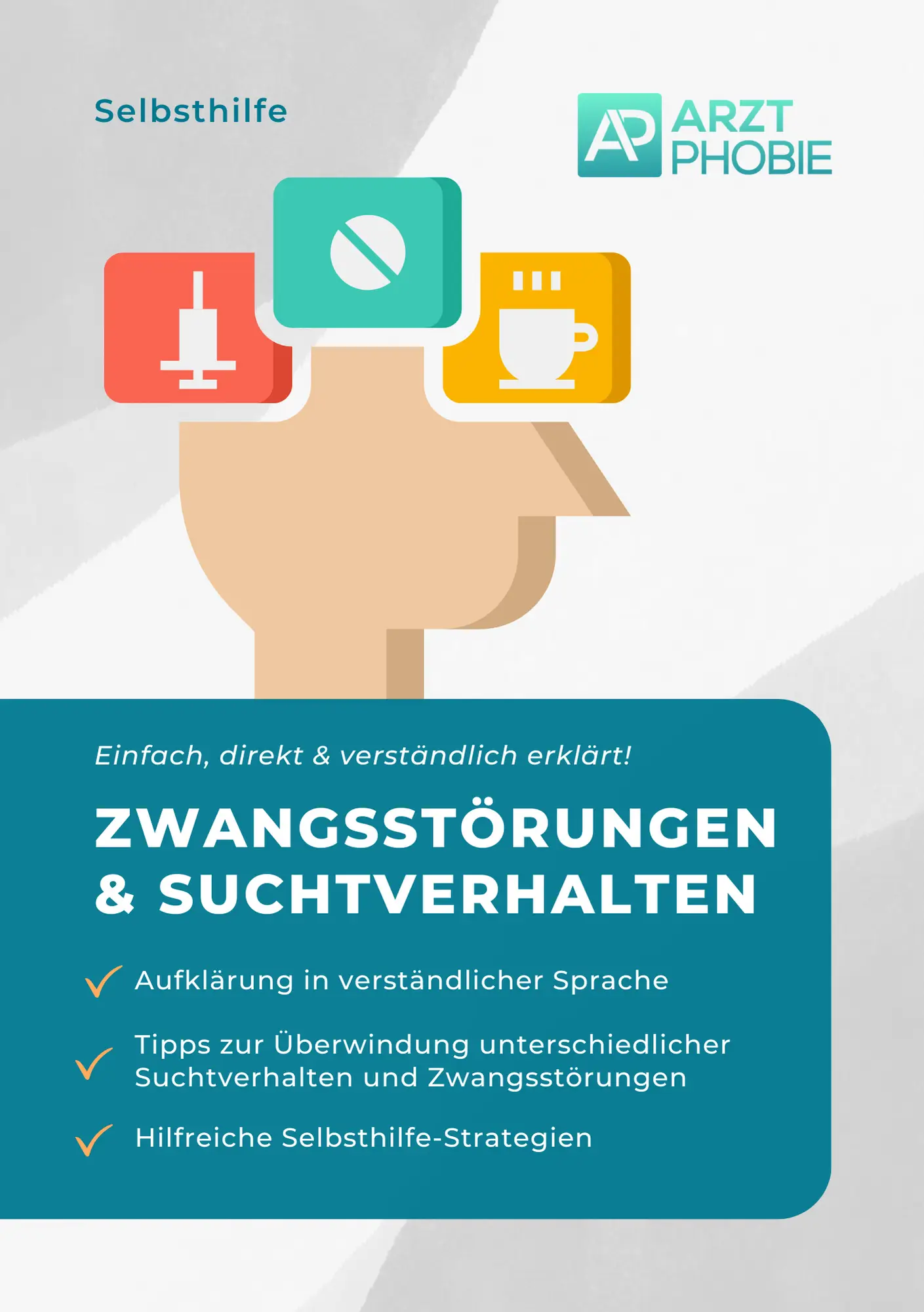
- Über 60 Seiten ✓
- In verständlicher Sprache ✓
- Mit Anleitungen und Übungen ✓
- Tipps für Sofort- & Selbsthilfe ✓
- Softcover: 19,00 EUR
- E-Book: 9,99 EUR
- ➡️ JETZT BESTELLEN ✓
FAQ zur Alkoholsucht
Alkoholsucht, auch als Alkoholabhängigkeit oder Alkoholismus bekannt, ist eine chronische Krankheit, bei der eine Person einen unkontrollierbaren Drang verspürt, Alkohol zu konsumieren, trotz negativer Folgen für ihre Gesundheit, soziale Beziehungen und Beruf.
Als alkoholabhängig gilt man dann, wenn innerhalb eines Jahres drei oder mehr der folgenden Punkte gleichzeitig zutreffen: Starkes Verlangen nach Alkohol; verminderte Kontrollfähigkeit hinsichtlich Beginn, Ende und Menge des Konsums; körperliche Entzugserscheinungen; Toleranzentwicklung; Vernachlässigung anderer Interessen zugunsten des Alkohols; fortgesetzter Konsum trotz schädlicher Folgen.
Das sogenannte Jellinek-Schema ist das am häufigsten in der Medizin verwendete Klassifikationssystem für Alkoholabhängigkeit. Entwickelt hat es der US-amerikanische Mediziner Elvin M. Jellinek bereits im Jahr 1960. Es umfasst vier Hauptphasen und 45 Stufen. Die Phasen sind die voralkoholische Phase, die Anfangsphase, die kritische Phase und die chronische Phase.
Die Behandlung einer Alkoholsucht gliedert sich in vier Phasen. In der Vorbereitungsphase wird die Therapie geplant und die Motivation des Patienten aufgebaut. In der Entgiftungsphase kommt es zum medizinisch überwachten körperlichen Entzug. Die Entwöhnungs- und Rehabilitationsphase hat die physische, psychische und soziale Stabilisierung des Betroffenen zum Ziel. In der Nachsorge geht es dann um die Festigung der Therapieerfolge durch den Besuch von Selbsthilfegruppen, Suchtberatungsstellen oder einer Psychotherapie.
Alkoholsucht entsteht durch eine Kombination von genetischen, psychologischen, sozialen und umweltbedingten Faktoren. Eine familiäre Vorgeschichte von Alkoholismus, persönliche psychische Probleme und Umweltfaktoren wie Stress oder Traumata können zur Entwicklung von Alkoholsucht beitragen.
Symptome der Alkoholsucht können sein: erhöhte Toleranz gegenüber Alkohol, Entzugserscheinungen bei Abstinenz, Vernachlässigung von Verantwortlichkeiten, sozialer Rückzug und die Fortsetzung des Alkoholkonsums trotz negativer Konsequenzen.
Die Diagnose von Alkoholsucht erfolgt in der Regel durch eine klinische Untersuchung, bei der ein Arzt oder Therapeut die Symptome, Verhaltensweisen und den Alkoholkonsum der betroffenen Person bewertet.
Eine Alkoholsucht kann zu schweren gesundheitlichen Problemen führen, wie Lebererkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, neurologischen Schäden und einem erhöhten Risiko für bestimmte Krebsarten.
Die Behandlung von Alkoholsucht umfasst in der Regel Entgiftung, Psychotherapie (z.B. kognitive Verhaltenstherapie), Medikamente zur Linderung von Entzugserscheinungen und Rückfallprävention, Selbsthilfegruppen und die Unterstützung von Familie und Freunden.
Die Entgiftung ist der erste Schritt in der Behandlung von Alkoholsucht. Sie dient dazu, den Körper von Alkohol und dessen schädlichen Substanzen zu befreien. Die Entgiftung kann ambulant oder stationär durchgeführt werden und beinhaltet medizinische Überwachung und gegebenenfalls Medikamente zur Linderung von Entzugserscheinungen.
Die Dauer der Behandlung variiert je nach Schweregrad der Alkoholsucht, individuellen Bedürfnissen und Umständen. Die Entgiftung kann einige Tage bis Wochen dauern, während eine umfassende Therapie und Nachsorge mehrere Monate bis Jahre in Anspruch nehmen können.
Quellen:
- Alkoholkonsum in Deutschland: Zahlen & Fakten – Bundesgesundheitsministerium
- Alcohol Addiction: Signs, Complications, and Recovery – healthline.com

Dieser Artikel wurde von Matthias Wiesmeier verfasst. Selbstständiger Schriftsteller und Webdesigner seit 2005. Fachbereiche: Gesundheit, Psychologie, Sport.


