Nosophobie
Die Nosophobie ist die Angst vor Krankheiten oder davor, krank zu werden. Das Problem daran: Eine Erkrankung, egal welcher Art, lässt sich nicht dauerhaft vermeiden.
Wenn du allerdings übermäßig viel und ständig Angst vor Krankheiten hast, beeinträchtigt das oft auch deinen Alltag. Dies kann sogar zur sozialen Isolation führen.
Wir setzen uns in diesem Artikel näher mit dieser Angststörung auseinander. Außerdem geben wir dir Tipps, wie du die Angst vor Krankheiten reduzieren kannst und dein Alltag somit wieder leichter bewältigt werden kann.
Unser Artikel ist werbefrei, einfach zu verstehen und mittels dem Inhaltsverzeichnis kannst du direkt zu den Themen springen, die dich interessieren
- Autor: Matthias Wiesmeier
- Aktualisiert: 12. April 2024
Alles in Kürze
Nosophobie, auch bekannt als die Angst vor Krankheiten oder die Befürchtung, krank zu werden, kann deinen Alltag erheblich beeinträchtigen und sogar zur sozialen Isolation führen. Sie unterscheidet sich von der Hypochondrie und Mysophobie, obwohl sie oft verwechselt wird.
Typische Symptome der Nosophobie beinhalten zwanghaftes Kontrollverhalten des eigenen Körpers, starke Nervosität bei den ersten Anzeichen von Unwohlsein, sowie das Vermeiden und Verstecken ihrer Ängste vor nahestehenden Personen.
Viele Betroffene suchen ständig im Internet nach Symptomen, in der Hoffnung, ihre Beschwerden bestätigt zu sehen. Bei Kontakt mit Regen fühlen sie sich zum Beispiel sofort krank und ängstigen sich dann, eine Krankheit zu haben, obwohl sie tatsächlich nicht krank sind.
Die üblichen Behandlungsformen beinhalten kognitive Verhaltenstherapie, die darauf abzielt, belastende innere Einstellungen zu identifizieren und zu ändern, sowie schädliche Verhaltensweisen zu erkennen und zu verändern.
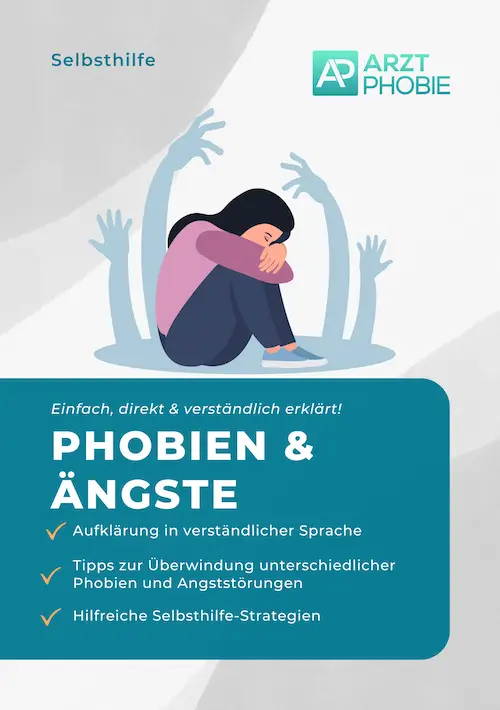
- Über 50 Seiten ✔
- Verständliche Sprache ✔
- Selbsthilfe Strategien ✔
- Tipps für Sofort-Hilfe ✔
- Softcover-Buch: 19,00 EUR ✔
- E-Book: 9,99 EUR ✔
- ➡️ JETZT BESTELLEN
Bedenken und Lösungen
| Bedenken | Lösungen |
|---|---|
| Ständige Internetrecherche nach Symptomen | Den Fokus auf eine gesunde Lebensweise setzen |
| Angst, bei Kontakt mit Regen krank zu werden | Das Verständnis von Krankheitsursachen erweitern |
| Angst vor einer bestimmten Krankheit | Professionelle medizinische Beratung suchen |
| Angst vor einer Panikattacke | Atemtechniken und Entspannungsübungen erlernen |
| Angst vor einer Krankheit, trotz fehlender Diagnose | Regelmäßige medizinische Untersuchungen wahrnehmen |
Die besten Tipps
Der erste Tipp ist, deine Ängste und Sorgen um deine Gesundheit als natürliche menschliche Reaktionen anzuerkennen. Statt diese Gefühle zu verdrängen oder zu ignorieren, akzeptiere sie und erlaube dir selbst, diese zu fühlen. Wenn sie jedoch dein tägliches Leben übermäßig beeinflussen, solltest du in Erwägung ziehen, professionelle Hilfe zu suchen oder unsere Selbsthilfe zu probieren.
Ein aktiver Lebensstil mit regelmäßiger Bewegung, gesunder Ernährung und ausreichendem Schlaf kann dazu beitragen, dein allgemeines Wohlbefinden zu verbessern und Ängste abzubauen. Versuche außerdem, Stressfaktoren zu reduzieren - Methoden wie Meditation oder Yoga können dabei hilfreich sein.
Unser Buch zur Selbsthilfe gegen Phobien und Ängste ist eine praktische Methode, um mit Ängsten umzugehen. Sie enthält verschiedene Techniken und Ansätze, die dir helfen können, deine Ängste Schritt für Schritt zu bewältigen und ein ausgeglicheneres Leben zu führen.
Was ist die Nosophobie?
Die Nosophobie wird im „Lexikon der Philosophie“ beschrieben als „nicht nachvollziehbare Befürchtung oder Verdacht, krank zu werden oder zu sein“.1Lexikon der Psychologie: Nosophobie – spektrum.de
Wer bei dieser Definition an Hypochondrie denkt, liegt zwar nicht ganz falsch, aber auch nicht ganz richtig. Die Nosophobie ist zwar eine sogenannte monosymptomatische Form der Hypochondrie. Auch mit der Mysophobie wird die Nosophobie oft verwechselt.
Hypochondrie
Während Nosophobiker Angst davor haben, in Zukunft zu erkranken und ihnen dabei klar ist, dass sie aktuell nicht krank sind, sind Hypochonder felsenfest davon überzeugt, bereits krank zu sein.
Ihre Befürchtung ist, dass sie nicht richtig diagnostiziert und adäquat behandelt werden. Die Angst des Nosophobikers richtet sich also auf Zukunft, jene des Hypochonders betrifft indes die Gegenwart.
Zwar treten beide Störungen oft in Kombination auf, zu verwechseln sind sie allerdings nicht. Mysophobiker leiden an der Angst, sich durch Keime, Bakterien oder anderen Dingen mit Krankheiten anzustecken. Die Angst vor Krankheiten steht also die Angst vor Ansteckung gegenüber.
Zweiter Punkt: Der zeitliche Aspekt. Während erst von Nosophobikern gesprochen wird, wenn die Störungen mindestens sechs Monate lang anhalten, zeichnet sich das Krankheitsbild der Mysophobiker durch seine Episodenhaftigkeit auf. Die Ausbrüche dauern in der Regel nicht besonders lange, sind aber dennoch unangenehm.
Anzeichen einer Nosophobie
Als klassische Phobie präsentiert sich die Nosophobie bei jedem Betroffenen etwas anders. Die Ausprägung verschiedener Aspekte variiert von Person zu Person.
Trotz dieser individuellen Unterschiede gibt es grundlegende Anzeichen, die beim Krankheitsbild der Nosophobie immer wieder auftreten, unabhängig von ihrer Intensität:
- Zwanghaftes Kontrollverhalten bezüglich des eigenen Körpers.
- Ausgeprägte Nervosität, sobald sich erste leichte Anzeichen von Unwohlsein bemerkbar machen. Fehl- und Überinterpretation vermeintlicher Symptome sind häufig.
- Teilweise tritt ein Vermeidungsverhalten auf, mit dem du versuchst, deine Nosophobie vor deinem engsten Umfeld zu verstecken. Was anfangs oft gut funktioniert, kann mit der Zeit zu einer enormen Belastung werden.
- Angst vor der Bestätigung des eigenen Verdachts durch den Arzt. Paradoxerweise bringt der Gang zum Arzt oft nicht die erhoffte Erleichterung. Selbst wenn medizinisch abgeklärt wurde, dass alles in Ordnung ist, bleibt die Nervosität, die Angst vor Krankheiten besteht weiter.
Gefahren der Nosophobie
Abgesehen von den sozialen Folgen, die eine Nosophobie mit sich bringt – wie eingeschränkter Kontakt zu anderen und Vereinsamung –, kann diese hypochondrische Störung auch körperliche Auswirkungen haben.
Das passiert vor allem, wenn du aus Angst vor einer negativen Diagnose oder der Bestätigung deiner Vermutungen einen womöglich notwendigen Arztbesuch gar nicht erst in Erwägung ziehst.
Kranke Gedanken machen krank?
Wir stehen hier vor einer bestimmten Paradoxie, die im Rahmen einer Nosophobie oft zu beobachten ist. Gerade weil du Angst davor hast, krank zu werden, tritt am Ende genau das ein, was du eigentlich verhindern wolltest: Du wirst krank.
Zu viele negative Gedanken können die Entstehung von Krankheiten begünstigen, was vor allem mit einem Überschuss an Stresshormonen (Cortisol) zusammenhängt.
Fakt ist auch: Während im Zuge mancher Vorsorgeuntersuchungen viele Krankheiten bereits im Frühstadium entdeckt und somit einfacher behandelt werden könnten, gestaltet sich die Behandlung umso schwieriger, je später die Probleme diagnostiziert werden.
Besonders häufiger Arztbesuch
Es gibt auch Fälle, in denen Betroffene überdurchschnittlich oft einen Arzt aufsuchen. Wenn dieser dann (üblicherweise) keine Probleme diagnostiziert, kann das dazu führen, dass du dich noch weiter in deine Angst hineinsteigerst, dich immer weiter zurückziehst und immer mehr von der Gesellschaft isolierst.
Eine Verweigerung des Arztbesuchs ist ebenfalls möglich. Wenn du befürchtest, dich beim Arzt mit Krankheiten anzustecken, meidest du diesen Besuch. Auch eine Angst vor Krankenhäusern oder eine generelle Angst vor Ärzten (Iatrophobie) ist eine mögliche Folge der Nosophobie.
Behandlung der Nosophobie
Bei Nosophobie handelt es sich um eine hypochondrische Störung der Psyche. Entsprechend gestalten sich die gängigen Therapiepraktiken, wobei Psychotherapie besonders hervorzuheben ist.
Als besonders geeignet hat sich die kognitive Verhaltenstherapie (KVT) erwiesen. Doch wie ist diese aufgebaut und wie kann sie dir helfen, wenn du unter Nosophobie leidest?
Ablauf der kognitiven Verhaltenstherapie: Wie der Name schon sagt, kombiniert die KVT zwei Ansätze: Die kognitive Therapie und die Verhaltenstherapie.
In der kognitiven Therapie konzentrierst du dich darauf, deine Gedanken, Erwartungen und Einstellungen zu reflektieren. Das Ziel ist es, schädliche Denkmuster zu erkennen und zu ändern, die zu deiner Angst beitragen.
In der Verhaltenstherapie arbeitest du an deinen Verhaltensweisen. Hier geht es darum, zu lernen, wie du anders auf Situationen reagieren kannst, die bei dir bisher Angst oder Vermeidungsverhalten ausgelöst haben.
Durch die Kombination dieser beiden Ansätze hilft dir die KVT, deine Angst vor Krankheiten zu verstehen und Schritt für Schritt zu überwinden. Du lernst, deine Ängste realistischer zu bewerten und mit ihnen umzugehen, statt sie zu vermeiden. Dies kann dir helfen, ein freieres und weniger von Angst bestimmtes Leben zu führen
Kognitive Therapie
Die kognitive Therapie lädt dich ein, dich mit dir selbst auseinanderzusetzen – mit deinen Erwartungen, Einstellungen und Gedanken. Im Idealfall hilft dir dieser Prozess, belastende innere Einstellungen zu identifizieren und zu ändern, sowie deine Denkmuster neu zu gestalten.
Das Ziel ist es, die Tendenzen zur Übergeneralisierung (also das Verallgemeinern) und Katastrophisierung (also das übertriebene Schwarzmalen) zu überwinden und mit realistischeren Einschätzungen durchs Leben zu gehen. Dieser Ansatz hilft dir, eine gesündere und realitätsnähere Sicht auf die Welt und dich selbst zu entwickeln.
Verhaltenstherapie
In der Verhaltenstherapie geht es im Kern darum, zu erkennen, dass menschliches Verhalten antrainiert bzw. erlernt ist. Das Tolle daran ist, dass alles, was du gelernt hast, auch geändert werden kann. Und genau hier setzt die Verhaltenstherapie an: Das Ziel ist es, Verhaltensweisen zu identifizieren, die dir im Alltag schaden.
Sobald solche Routinen aufgedeckt sind, arbeitest du daran, diese zu verändern. Bei Phobien liegt ein besonderer Fokus darauf, beruhigende Routinen zu lernen und zu verinnerlichen.
Die Kombination aus kognitiver und Verhaltenstherapie schafft ein mächtiges Werkzeug, das besonders gut geeignet ist, um Angststörungen wie der Nosophobie entgegenzuwirken.
Ablauf einer kognitiven Verhaltenstherapie
In einem Grundlagengespräch werden die zu behandelnden Probleme ebenso skizziert wie deine Erwartungen und Hoffnungen.
Danach folgt die gemeinsame Festlegung der Therapieziele und des Behandlungsplans. Sollte sich an den Zielen etwas ändern, wird der Ablauf der Behandlung entsprechend angepasst.
Ein wichtiger Bestandteil einer KVT ist oftmals das Führen eines Tagebuchs. Gemeinsam mit deinem Therapeuten werden die Einträge anschließend analysiert.
Sind deine persönlichen Einschätzungen nachvollziehbar? Bewirken Änderungen in deinem Verhalten auch Änderungen in deinem Umfeld?
Dazu kommt das Erlernen von Problemlösungsstrategien und Entspannungsübungen. Üblicherweise wird mit wöchentlichen Therapiesitzungen gearbeitet.
Du bestimmst das Tempo!
Ein guter Therapeut diktiert das Tempo der KVT nicht, sondern passt sich an dich an. Solltest du dich unwohl fühlen, äußere deine Bedenken!
Klassische Nebenwirkungen von Psychotherapien waren bisher noch so gut wie kein Thema einer wissenschaftlichen Auseinandersetzung. Besonders im Anfangsstadium einer Behandlung kann es passieren, dass sich Patienten unsicher und überfordert fühlen.
Es ist normal, sich anfangs etwas unsicher zu fühlen, aber ein offener Dialog mit deinem Therapeuten kann helfen, diese Herausforderungen zu überwinden und den Therapieerfolg zu maximieren.
Beispiel Ablauf:
Hier ein Beispiel, wie die KVT bei der Angst vor Krankheiten angewandt werden kann:
Stell dir vor, du hast ständig Angst, ernsthaft krank zu sein. Jedes Mal, wenn du eine ungewöhnliche Körperempfindung verspürst, interpretierst du diese sofort als Anzeichen einer schweren Krankheit. Diese automatische Gedankenverbindung ist ein Beispiel für Katastrophisierung.
In der KVT würdest du zunächst daran arbeiten, diese automatischen Gedanken zu erkennen und in Frage zu stellen.
Ein praktisches Beispiel hierfür wäre das Führen eines Gedanken-Tagebuchs, in dem du festhältst:
- Die spezifische Situation (z.B. Kopfschmerzen beim Aufwachen).
- Deine automatischen Gedanken dazu (z.B. „Das muss ein Hirntumor sein“).
- Die tatsächlichen Beweise, die diese Gedanken unterstützen (oft gibt es hier wenig bis gar keine).
- Alternative, realistischere Gedanken (z.B. „Ich habe wahrscheinlich Kopfschmerzen, weil ich gestern zu wenig getrunken habe oder mein Kissen nicht richtig lag“).
Durch diese Praxis lernst du, deine Tendenz zur Katastrophisierung zu reduzieren und stattdessen mit realistischeren Einschätzungen auf Körperempfindungen zu reagieren. Zusätzlich könnten Entspannungsübungen oder das Erlernen von Achtsamkeitstechniken dir dabei helfen, deine körperliche Reaktion auf Angst zu mindern und so einen gelasseneren Umgang mit deinen Gesundheitssorgen zu entwickeln.
Tipps gegen die Angst Krank zu werden
Bis zu einem gewissen Grad ist es durchaus verständlich, dass du Angst hast, ständig krank zu werden oder mit Krankheiten infiziert zu werden. Im Folgenden nennen wir hilfreiche Tipps, um die übersteigerte Angst vor Krankheiten etwas reduzieren zu können:
Informiere dich über die Krankheiten, die dich am meisten beunruhigen. Hole dir Fakten von seriösen Quellen und vermeide es, dich von unbestätigten Informationen oder Gerüchten über Krankheiten verängstigen zu lassen. Dr. Google kann auch krank machen, wenn du dich falsch informierst oder durch furchteinflößende Berichte in Panik gerätst.
Wasche deine Hände häufig und gründlich, vermeide es, dein Gesicht zu berühren, und desinfiziere regelmäßig Oberflächen, die du häufig berührst. Dies kann dazu beitragen, die Ausbreitung von Krankheiten zu reduzieren. Verfalle dabei aber nicht in ein krankhaftes Verhalten, denn zu viel Hygiene kann das Immunsystem auch schwächen.
Iss gesunde Lebensmittel, treibe regelmäßig Sport, und achte auf ausreichenden Schlaf. Ein gesunder Lebensstil kann das Immunsystem stärken und das Risiko von Krankheiten verringern. Nicht immer ist es hilfreich, jegliche Aktivität an der frischen Luft zu vermeiden. Auch ein Spaziergang im Regen kann hilfreich sein, um das Immunsystem zu stärken.
Wenn du dich unwohl fühlst, in Kontakt mit Menschen zu sein, die krank sind, setze Grenzen und vermeide es, dich unnötigen Risiken auszusetzen. Es ist entscheidend, auf deine Gesundheit und dein Wohlbefinden zu achten. Allerdings solltest du den Kontakt zu Menschen nicht komplett vernachlässigen. Durch den Kontakt mit unseren Mitmenschen kann unser Immunsystem auch gestärkt werden. Wer dauerhaft in Isolation lebt, kann sein Immunsystem schwächen.
Wenn du unter Angstzuständen oder ständiger Sorge leidest, suche professionelle Unterstützung. Sprich mit einem Therapeuten oder Berater über deine Ängste und erarbeite gemeinsam Strategien zur Bewältigung.
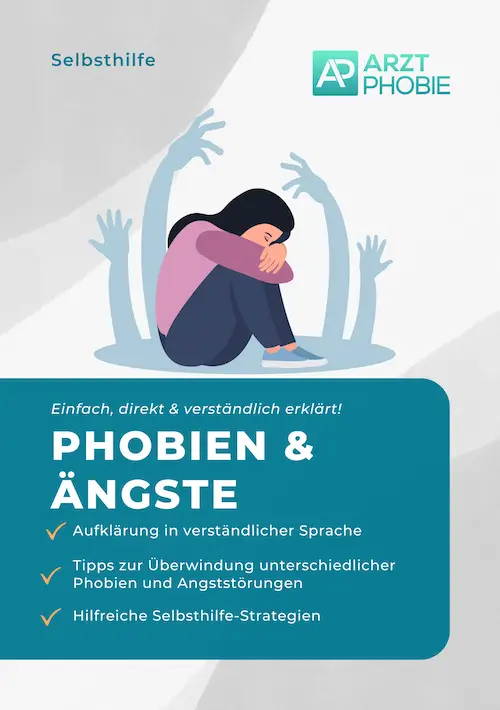
- Über 50 Seiten ✔
- Verständliche Sprache ✔
- Selbsthilfe Strategien ✔
- Tipps für Sofort-Hilfe ✔
- Softcover-Buch: 19,00 EUR ✔
- E-Book: 9,99 EUR ✔
- ➡️ JETZT BESTELLEN
Schamgefühle überwinden
Niemand wird gerne krank. Und bestimmte Vorsichtsmaßnahmen zu befolgen ist auf jeden Fall eine gute Idee. Wird dabei aber ein Punkt überschritten, wird das Verhalten zwanghaft, dann steht möglicherweise die Diagnose „Nosophobie“ im Raum.
Das Leben von Betroffenen wird von dieser hypochondrischen Angststörung auf zweierlei Arten negativ beeinflusst. Das Sozialleben leidet meist massiv. Nosophobiker legen Vermeidungsverhalten an den Tag und reduzieren Kontakte meist drastisch.
Wer stark unter der Angst vor Krankheiten leidet und dadurch seinen Alltag massiv einschränkt, kann profesionelle Hilfe in Anspruch nehmen. Eine Nosophobie wird üblicherweise mit psychotherapeutischen Methoden behandelt. Am effektivsten hat sich bisher die kognitive Verhaltenstherapie erwiesen.
Damit man die Ängste mit einem Psychologen besprechen kann, sollte man grundlegend keine Angst oder Schamgefühle vor Therapeuten und Ärzten haben. Mit unseren Selbsthilfe Ratgeber Artikel gegen die Arztphobie möchten wir Ihnen unter die Arme greifen und dabei helfen die Ängste zu reduzieren.
Selbsthilfe anwenden
Für diejenigen, die zögern, wegen ihrer gesundheitlichen Ängste professionelle Hilfe zu suchen, kann ein erster Schritt sein, es mit Selbsthilfe zu versuchen. Unsere Selbsthilfe Anleitung gegen Phobien und Ängste kann in solchen Situationen Unterstützung bieten.
Quellen:
- Lexikon der Psychologie: Nosophobie – spektrum.de
- Understanding Nosophobia, or Fear of Disease – healthline.com
- Nosophobia (Fear of Disease): Causes, Symptoms & … my.clevelandclinic.org
- Nosophobia: Fear of Getting an Illness, Related Disorders … webmd.com
- What to Know About Nosophobia or Fear of a Disease – verywellmind.com

Dieser Artikel wurde von Matthias Wiesmeier verfasst. Selbstständiger Schriftsteller und Webdesigner seit 2005. Fachbereiche: Gesundheit, Psychologie, Sport.
Autor und Überprüfung:
Autor: Matthias Wiesmeier – Medizinische Überprüfung: Thomas Hofmann


